|


|
Das
Modell "Medienintegrierter
Deutschunterricht" wurde in den Jahren
1992-2000 an der Neuen Kantonsschule Aarau
nach Rücksprache mit dem Rektorat und
im Kontakt mit der pädagogischen
Beratungsstelle des Kantons Aargau
initiert und gestützt auf die Lehr-
und Methodenfreiheit dennoch im Alleingang
von Armin Schlienger realisiert
(siehe
effektive Projektrealsierung).
Das Projekt kann als Potenzierung,
zumindest aber als Adaptation des
"Projektunterrichts" oder
"PSU"(pädagogisch sozialer
Unterricht) gelten, der als Kernfach
des Pädagogisch-Sozialen
Gymnasiums während mehr als 20
Jahren erfolgreich praktiziert wurde. Das
Projekt Medienintegrierter
Deutschunterricht übernimmt vom PSU
die meisten Unterrichtsformen und
Erfahrungen, deren ganzheitliches Anliegen
sich summarisch mit den bekannten drei
Fundamental-Kompetenzen
(siehe
Kompetenzen),
sicher aber auch mit Pestalozzis
ganzheitlichem Ansatz
"Kopf-Hand-Herz" umreissen
lässt, oder aber mit dem keineswegs
veralteten Motto die "Person
stärken" und die "Sache
erhellen".
Für dieses ominöse "Person
stärken" in einem weitergehenden
Modell eigenständigen Lernens mussten
die 16- / 17- jährigen
Gymnasias/tinnen aber erst gewonnen
werden. Den ganzheitlichen Prozess
"selbstverantwortlichen Lernens" pflegte
ich als Kernvorstellung den Lernenden
gegenüber sinnlich konkret zu
verdeutlichen, indem ich das Grundanliegen
als "PRINZIP SONNENBLUME "
beschrieb: das Projekt "Eigenständig
lernen mit Bild, Ton und Text" will die
Schüler/ innen anhalten, sich radikal
(sic) bewusst im "realen Erdreich", ihrer
Herkunft, ihrer eigenen Kultur, ihrer
ureigenen Motivation zu verwurzeln, um
sich in der Auseinandersetzung mit Leben
und Lernstoff - anders als Schnittblumen -
jederzeit voll dem Lauf der Sonne zuwenden
zu können. Wissenschaftlicher
ausgedrückt wäre hier eher von
Metakognitions-Schulung (siehe
Metakognition) zu
sprechen.
Zum historischen Umfeld des Projekts
Medieninegrierter Deutschunterricht
gehört aber auch das am
Pädagogisch-Sozialen Gymnasium seit
den 70-er Jahren offiziell praktizierte
Teamteaching des erwähnten
typenspezifischen Projektunterrichts
(PSU). Ganz speziell der Zusammenarbeit
mit Beat Trottmann, aber auch den
konstruktiven Disputen mit Christina Kunz
1.) verdanke ich vorab den Mut zu diesem
radikalen Projekt ,aber auch eine
ausbaufähige Praxis im Umgang mit
einer ganzen Reihe zentraler Instrumente
wie z.B. Logbuch, Konzeptarbeit und
Selbstevaluation.
|

|
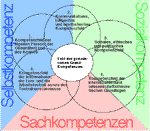
|
Zum historischen Umfeld sind auch
die Rahmenlehrpläne des MAR zu
zählen. Die von den
Erziehungsdirektionen in Gang gesetzte
Gymnasialreform (MAR) verlangte eine
fundamentale Erneuerung des Unterrichts
mit grundlegend revidierten Bildungs- und
Maturitätszielen
(siehe
Kompetenzfelder
des MAR)
. Diese von Bildungsforschern und
Gymnasiallehrer-Verbänden in den
sogenannten "Rahmenlehrplänen"
dargelegten "Kompetenzen" bilden die Basis
dieses Modells "Eigenständigen
Lernens mit Bild, Ton und Text". Sie
vertiefen und präzisieren die Trias
der Selbst-, Sozial- und Sachkompetenzen.
|

|
|
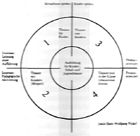 in:
Kleintheaterarbeit S. 95 in:
Kleintheaterarbeit S. 95
|
Vorbilder und Anregungen
Ganz erheblichen Anteil an
Zustandekommen und Gelingen des Projekts
Medienintegrierter Deutschunterricht
dürften aber die
Schultheaterkurse haben, die ich
bereits Ende der 70-er Jahre mit der
IBA-Schauspielerin Marianne Burg und
später der Theaterpädagogin
Marlies Zwimpfer-Kämpfen zusammen an
der Neuen Kantonsschule Aarau leitete. Da
lernte ich Prinzip und Techniken der
Animation kreativer Prozessen
konkret kennen. Zentral beeinflusst
wurde meine berufliche Haltung aber ebenso
durch Idee und Praxis des
Ensemble-Theaters, die ich als
nebenamtlicher Dramaturg an der
Innerstadtbühne Aarau (IBA) Ende
70-er bis Anfangs 80-er Jahre kennenlernte
und deren Grundsätze ich bereits 1975
für die Festschrift
"KLEINTHEATERARBEIT" formulierte und
ansatzweise auf das Schultheater
übertrug 2).
Zu den massgebenden Impulsen und
Vorbildern für das Projekt des
"Medienintegrierten Deutschunterrichts"
gehören letztlich ganz konkret die
Schulversuche von Aargauer Real-,
Sekundar- und
Bezirksschullehrer/innen, deren Wirken
ich in Absprache mit der
pädagogischen Arbeitsstelle
anlässlich eines Lehrfilmprojekts
über neue Lernkulturen von innen
kennenlernte. Dabei erhielt ich auch
fundamentale Anregung durch den
Projektleiter Norbert Landwehr und seine
"Neuen Wege der Wissensvermittlung" 3.) .
Stete Ermutigung gegen vielfältige
Widerstände verdanke ich zudem Walter
Weibel, dem Leiter der "Pädagogischen
Arbeitstelle" des Kanton Aargau.
|
ˆ
|
|
|
Im
Verlauf des Projekts vertieften sich diese
Anregungen durch die Schriften 4) der
Pädagogischen Hochschule
St.Gallen und die Lernforschung von
Erwin Beck, Titus Guldimnann und Michael
Zutavern, in deren Reihe "Kollegium" das
Modell "Medienintgerierter
Deutschunterricht" etwa zur Halbzeit des
Projekts erstmals publiziert wurde 5); ein
zweitesmal übrigens als kurzer Anhang
in 6).
|
|
|
|
Zwei Initialzündungen
Die eigentliche Initialzündung
jedoch ging zum einen von einem
NZZ-Artikel über das Medien-Konzept
des Evangelisch Stiftischen Gymnasiums in
Gütersloh (NZZ , 7. 5. 1992) und zum
andern von der projektförmigen
Lehrlingsausbildung der Firma Landis &
Gyr aus, die ich anlässlich einer
Weiterbildung des Didaktikums kennen
lernte (siehe
"heisse
Projekte").
Da wollte ich nicht zuwarten, bis
irgendwann irgendwo ein Team mit
vollkommenem einheimischem Konzept
für die Sekundarstufe II vom Himmel
fallen würde; ich wagte den Start und
informierte Schulleitung,
Inspektorenkonferenz und die
"Pädagogische Arbeitsstelle" in
Aarau, deren Leiter Walter Weibel mich
kollegial unterstützte.
|

|
1)
Christina Maria Kunz-Koch. Geniale Projekte
-Schritt für Schritt entwickeln. Ein Leitfaden
zur persönlichen Strategieentwicklung in
Projekten für Wirtschaft, Berufsschulen,
Gymnasien, Universitäten und zum Selbststudium
(orell füssli Verlag AG); Zürich
1999.
2)
Kleintheaterarbeit
Zur Situation des Kleintheaters in der Schweiz.
Die aargauischen Kleintheater.
10 Jahre Innerstadtbühne Aarau. Aarau 1975
(Konzept,
Redaktion und mehrere Artikeln von Armin
Schlienger; z.B. S. 93-95 "Theater von Kindern,
Schülern und
Jugendlichen")
3) Norbert Landwehr. Neue Wege der
Wissensvermittlung. Ein praxisorientiertes Handbuch
für Lehrpersonen im Bereich der Sekundarstufe
II (Berufsschulen, Gymnasien) sowie in der Lehrer-
und Erwachsenenbildung (Berufspädagogik bei
Sauerländer; Band 20); Aarau 1994.
4) Erwin Beck, Titus Guldimnann und Michael
Zutavern (Hg.). Eigenständig lernen.
Kollegium.Schriften der Pädagogischen
Hochschule St.Gallen, hsg. v. Werner Wunderlich,
Peter Geiger, Hans Maurer, Alfred Noser, Peter
Wegelin. UVK Fachverlag für Wiss.und Studium,
St.Gallen 1995.
5) in: Erwin Beck, Titus Guldimnann und Michael
Zutavern (Hg.). Lernkultur im Wandel.
Tagungsband der Schw. Ges.für Lehrerinnen- und
Lehrerbildung und der Schw. Ges. für
Bildungsforschung. Kollegium. Schriften der
Pädagogischen Hochschule St.Gallen, hsg. v.
Peter Geiger, Oskar Keller, Alfred Noser, Erwin
Stickel. UVK Fachverlag für Wiss.und Studium,
St.Gallen 1997; S.231-254.
6) Medienpädagogik für eine auf das
Lernen ausgerichtete Schule.
In: Hans Dieter Erlinger/Gudrun
Marci-Boehncke(Hrsg.) Deutschdidaktik und
Medienerziehung. Kulturtechnik Medienkompetenz in
Unterricht und Studium. KoPäd Verlag,
Münschen 1999: S.129-154.
|