|
|
Information
der
Schulbehörden
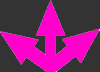
|
Offiziell
war der Rektor der Neuen Kantonsschule
Aarau im voraus von mir über den
"Medienintegrierten Deutschunterricht" als
ein ziemlich konsequentes Modell
eigenständigen Lernens im Rahmen
meiner fachunterrichtlichen Lehr- und
Methodenfreiheit ins Bild gesetzt worden.
Bereits kontaktiert hatte ich auch die
kantonale pädagogische Arbeitsstelle,
die mir zu diesem grossen Projekt Mut
machte; die erhoffte wissenschaftliche
Begleitung und Evaluation des Projekts
hatten die Berater, die bereits vier
Schulprojekte betreuten, mir allerdings
nicht zusagen können. Auf mein
Ersuchen konnte ich nach zwei, drei
Semestern den in den Rektoratsräumen
versammelten Inspektoren während rund
20 Minuten das Projekt vorstellen - man
liess mich ohne Einspruch
gewähren.
(Zum Umfeld des Projekts siehe
"history"
ersten Teil).
|
|
|
Information
von
Eltern und
Kollegschaft
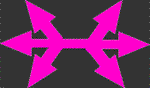
|
Der
"Medienintegrierter Deutschunterricht"
wurde in der alltäglichen Praxis
weder vom Rektor, noch von den Inspektoren
noch von den Kolleg/innen besucht - von
ganz wenigen freundschaftlichen Kontakten
abgesehen oder einer
Französischlehrerin, die als
Zuschauerin bei einer theatralischen
Präsentation mitmachte, und den
grossen Theateraufführungen meiner
Klassen, bei denen gewiss auch
Kolleg/innen im Publikum sassen.
Ich musste also über
ausführliche Wandzeitungen an den
jährlichen Besuchstagen Eltern und
Lehrerschaft über Sinn, Zweck und
Form des Projekts informieren, was ich in
den ersten Jahren zwei, drei Mal
versuchte.
|

|
|
Publikation
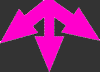
|
Erst
Oktober 1996 konnte ich am St.Galler
Kongress "Lernkultur im Wandel" an einem
kleinen Treffpunkt das Modell erstmals
vorstellen; veröffentlicht wurde der
Tagungs-Katalog im Frühjahr 1997. Ein
zweites Mal skizzierte ich das Modell im
Herbst 1998 auf dem Symposion
Deutschdidaktik in Siegen, worauf ich es
auch im Anhang zum Tagungsband vom Februar
1999 in "Deutschdidaktik und
Medienerziehung" (kopaed) kurz
präsentieren durfte. Ausserdem wurde
die alltägliche Praxis des
Medienintegrierten Deutschunterrichts drei
Mal von auswärtigen
Gymnasiallehrergruppen (darunter Leute von
der WBZ) besucht - mit anregenden
anschliessenden Gesprächen (und teils
jahrelangem freundschaftlichem Kontakt).
Und zweimal lud mich Theo Byland, ein
ebenso engagierter Französischlehrer
aus dem Kollegium der NKSA ins Höhere
Lehramt der Uni Zürich, um angehenden
Gymnsaiallehrer/innen diesen
Deuischunterricht vorzustellen. Das
externe Interesse war vergleichsweise
riesig.
|
ˆ
|
|
negative
Resonanz
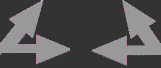
|
Schwer
zu verkraften waren nach den externen
Besuchen die zunehmenden Widerstände
gegen den Medienintegrierten
Deutschunterricht aus dem Aarauer
Lehrerkollegium. Eine Musiklehrerin
beschwerte sich massiv in einer
Lehrerkonferenz, dass die beteiligten
Schüler/innen nicht mehr übten
und Montags unvorbereitet in die
Violinstunde kämen, weil sie jeweils
Sonntags im Schulhaus am Projekt
arbeiteten. Der Rektor wollte mir den
Schulhausschlüssel entziehen, weil
die unbeaufsichtigten Schüler/innen
Sonntags ja damit unbefugt in sensible
Räume hätten eindringen
können.
Erstaunlicherweise wurde das Modell
Eigenständig Lernen mit Bild, Ton und
Text auch danach nicht behindert. Im
Frühjahr 2000 wurde mir sogar
gestattet, einen Weiterbildungstag
"Eigenständig Lernen" für das
Lehrerkollegium zu veranstalten -
allerdings im Alleingang und während
der Maturitätsprüfungen - aber
mit Unterstützung von Freunden aus
dem Kollegium und der Mitwirkung zweier
Kollegen aus dem Didaktikum.
|

|
|
Akzeptanz
von innen
|
Mangels
wissenschaftlicher Begleitung bleibt die
Einschätzung höchst subjektiv:
ohne "optimistische" Sicht wäre es
wohl unmöglich, ein solches Projekt
aufzugleisen, durchzuführen und
weiterzuentwickeln. So fragwürdig die
folgende Gesamteinschätzung klingen
mag, auch in der Retroperspektive sind es
die jungen Menschen, die mich durchhalten
liessen, ihr zunehmend selbstbewussterer
Gang, ihre erstarkende Selbstbestimmung,
ihr Erfolg auch in den andern
Fächern. Und zutiefst beeindruckend
sind für mich natürlich die
fachlichen Leistungen*, die schon teils
schon im ersten Semester einstellten -
selbst im heiklen Bereich der
Lerntagebücher. Das war eine
unglaublich spannende, dankbare
Aufgabe.
Meines Erachtens ist das Lernmodell -
summa summarum - von den Lernenden voll
akzeptiert und vor allem weitestgehnend
adaptiert worden.
*)
in dieser Darstellung wird einzig eine
Serie von Bild/Text-Beispielen
dokumentiert; siehe
"medienintegriert:
bild und
text"
|
|
|
Rahmenbedingungen
|
Wenn
das Projekt seitens der Lernenden wirklich
ein durchgehenderr Erfolg war, wie ich es
einschätze, dann gab es dafür
eine Reihe sehr guter Gründe, die ich
unbedingt aufzeigen muss:
1. räumliche
Voraussetzungen:
Der gesamte Deutschunterricht dieses
Projekts konnte mit allen Klassen ins
Reserve-Schulzimmer in den Keller (mit
indirektem Sousol-Tageslicht) verlegt
werden: direkte Immissionen wurde so
vermieden; mit dem Abwart setzten wir uns
ins Einvernehmen wegen der höheren
Unordnung, die über Wochen kreative
produzierende selbstorganisierte Gruppen
phasenweise hinterlassen.
Ausserdem befand sich neben dem
Schulzimmer ein zweiter Reserveraum
(ebenfalls eine ehemalige
Militärunterkunft), den ich als
Leiter des Darstellenden Spiels bereits
für das Schultheater in Beschlag
genommen hatte und über den ich frei
verfügen konnte. Fast frei
verfügbar waren auch die
unbenützten Gänge und Nischen im
Untergeschoss. Zudem war die Neue
Kantonsschule damals schon mit einer
geräumigen Mediothek samt Cafeteria
ausgestattat
2. technische Ausstattung:
Für den "Medien"-integrierten
Deutschunterricht und seine
Präsentationen elementar war zum
einen der grosse speziell hergerichtete
Theaterraum mit optimaler mobiler
Theaterbeleuchtung. Zum andern hatte ich
als Lehrbeauftragter für Medienkunde
auch freie Verfügung über die in
meinem Deutschzimmer deponierten Monitore
und Videokameras, Tongeräte und sehr
bald auch einen Internetzugang - die
gesamte Computerausrüstung (PC und
Mac samt Programmen, Scanner, Drucker und
CD-Brenner) musste ich allerdings aus
privaten Mitteln beschaffen, wie
übrigens auch die erste Video-Studio
Ausrüstung mit drei sanchron
schaltbaren Kamerras und passendem
analogem Kameramischer.
3. Stundenplan:
Am damaligen Pädagogisch-sozialen
Gymnasium beanspruchte das Fach Deutsch 5
Wochenstunden. Dank der Möglichkeit,
pro Schuljahr Stundenplanwünsche zu
beantragen, liess sich ein
Dreistundenblock für das
Hauptprogramm (eigenständige
Projektteams) und eine Doppelstunde
für das Nebenprogramm
(angeleiteter Unterricht inkl.
Aufsatzprogramm; in der zweiten
Semsterhälfte von Fall zu Fall aber
auch für Präsentationen dem
Hauptprogramm unterstellt) einrichten.
Nicht ganz so grosszügig war die
Dotation für die neusprachlichen
Klassen. Hier musste das Hauptprogramm
sich mit 2 Stunden begnügen, bekam
aber öfters auch die Doppelstunde des
Nebenprogramms zugesprochen.
|

|
|
Profilanforderungen
und Empffehlungen
für Projektleiter
|
1.)
Dass man für diese Aufgabe nebst
fachlich ausgebildetem Gymnasiallehrer
auch noch Medienbeauftrager und
Schultheaterleiter mit professioneller
Kleintheatererfahrung sein muss, ist
hilfreich, aber keine unabdingbare
Voraussetzung. Als Profilanforderung davon
ableit- und definierbar ist hingegen die
Bereitschaft und Fähigkeit,
Kreative Prozesse anzuleiten , verstehen
und bewerten zu lernen.
2)
Ableitbar aus den acht Jahren Erfahrung
ist allerdings ganz generell: falls diese
Kompetenzen nicht in einer einzigen Person
vereint sind - und das dürften sie
wohl recht selten sein - , dass man solche
Projekte ohnehin mit grösserer
Erfolgsaussicht mindestens zu zweit,
besser zu dritt oder viert initiiert und
kooperativ, nach Massgabe der beteiligten
Kompetenzen, sehr viel umsichtiger leiten
kann. TEAMTEACHING
(siehe
"lehrerrollen")
ist in solch komplexen Prozessen nur schon
deshalb sinnvoller, weil sich das Projekt
mit einem Leitungsteam im Kollegium besser
abstützen lässt.
Und eine allerletzte Empfehlung oder
Forderung:
Ein so radikal angelegtes Modell in einem
so langen Projektrahmen verdient nicht
nur, sondern es braucht unbedingt eine
WISSENSCHAFTLICHE BEGLEITUNG und
AUSWERTUNG. Alles andere ist
Verschleuderung von Kraft , Erfahrung,
Kompetenz und Wissen. Zwar hatte
semesterweise ein Team pro Klasse die
Möglichkeit, eine Videodokumentation
über die Arbeit der andern Teams zu
erarbeiten - eine ausserordentlich
ergiebige, oft auch sehr kritische
Auseinandersetzung für die
Evaluationsphase war damit gegeben -, aber
diese interne Sicht kann keine
wissenschafrliche Auswertung ersetzen.
Anmerkung:
Das Laptop, auf das ich hinsichtlich der
bevorstehenden Pensionierung alle
digitalen Dokumente zusammentrug, wurde
mir gestohlen. Darauf ich "entsorgte" ich
auch die altersschwachen analogen
Videobänder sowie sämtliche
Bild-, Ton- und Textoriginale - auch an
der Pädagogischen Hochschule war kein
grösseres Forschungsinteresse
für radikales eigenständiges
Lernens und Weiterbildung von Dozierenden
fin selbstorganisiertem Lernen auszumachen
als am Gymnasium.
|

|
|