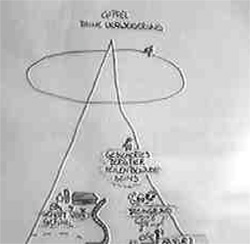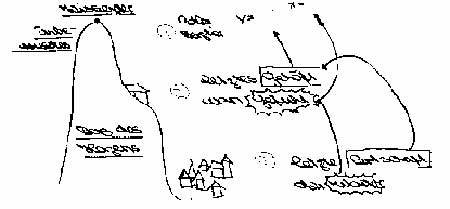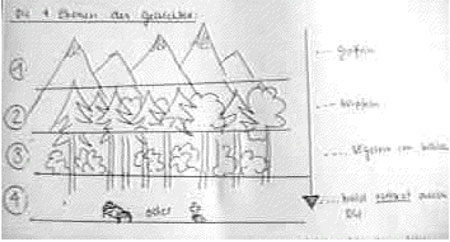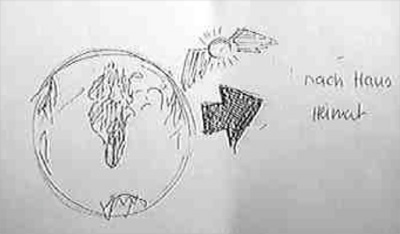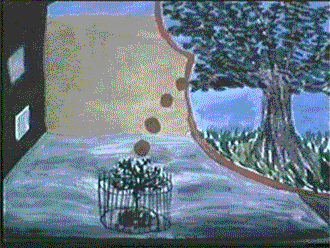|
|
|||||||||||||||||||||
|
Präsentation
der zentralen Lernschritte ist
der zweite Hauptpfeiler des Projekts "Medienintegrierter
Deutschunterricht. Eigenständig lernen mit Bild, Ton
und Text". In folgender Darlegung möchte ich die
medienspezifische Argumentation vorerst noch
zurückstelllen zugunsten einer unorthodo-pragmatischen
Darstellung mit Beispielen von überraschend
aussagekräftigen Schülerarbeiten. Diese
demonstrieren, wie Bild und Text einander gegenseitig
stützen und bedingen. Fragwürdig bleibt dabei
allerdings die folgende, auf wenige Beispiele verkürzte
schriftliche Darstellung all der vielfältigen, oft
höchst kreativen Entdeckungen und Lösungen nur
schon im Vergleich mit der schon viel angemesseneren
Präsentation im Kongress-Treffpunkt 19 vom 3. 10. 96,
wo sich mit Tonband, Dias und Videofilmen die
kreativ-kognitiven Leistungen greifbarer fokussieren
liessen. Dennoch dürften auch in der Beschränkung
auf "zeichnungen" wesentliche Grundzüge einer von
diesem Modell favorisierten Wandlung des fachdidaktisch
engen Textbegriffs zum bereichsdidaktischen Text als einem
Gefüge von Bild, Ton und Sprache sichtbar werden.
Ähnlich macht
auch eine Zeichnung zu Goethes Gedicht "Ein Gleiches" vier
Ebenen sichtbar und bewusst, wie unter "allen Gipfeln"(der
obersten Ebene) in der zweitobersten Ebene der letzte Hauch
ausgehaucht, dann in der vorletzten der Vogelsang
ausgeblendet und in der letzten der Blick ins Grab
geführt wird, Dieses Bild/Text-Verhältnis drint
aber spürbar tiefer ins Gedicht ein, spürt
Sinnstrukturen auf, indem es sie bildlich ausformuliert: Ein
Gleiches (Johann
Wolfgang von Goethe, 1749-1832)
In einer weiteren
Zeichnung nimmt eine Schülerin bei Eichendorffs
"Mondnacht" die moderne Sicht einer Satelittenkamera ein und
sieht aus dem All zu, wie der Wolkenhimmel sich still zum
Kuss der Erde zuneigt und wie die Erde im
Blütenschimmer von ihm nun träumt. Damit ist der
Schülerin "zeichnend" eine neue, kosmische Deutung
geglückt, die man "lesend" kaum je entwickelt; so kann
sie selbst den Flug der Seele "als flöge sie nach Haus"
eigentümlich klar darstellen. Offensichtlich entwickeln
sich solche Zeichnungen rasch über blosse
texterläuternde Lesehilfe hinaus; sie ermöglichen
eine eigenständig-textgetreue, aber heutig-aktuelle
Vorstellung, die nicht minder grossartig ist als die
damalige Sicht einer zeitgenössischen Leserin aus dem
Gras heraus auf den Kuss der Himmelswolke am Horizont. Diese
bildnerische Funktion wächst aus der Lesehilfe heraus
und steigt ganz beiläufig auf zu einer zweiten
Funktions-Ebene, die man wohl Anverwandlung durch eigene
Anschauung nennen müsste. Mondnacht
1.Strophe (J. v. Eichendorff) Mondnacht
(1834) Es war, als
hätt der Himmel Interessant ist auch
die Verwendung der Zeichensprache eines andern
Codes(Sprechblase der Comics), die von einer weiteren
Zeichnerin noch viel freimütiger für Brechts
"Pflaumenbaum" benutzt wird. Die analytische Schärfe
ihrer im Stil von Kinder-Zeichnungen gehaltenen Bilder wird
dabei bei der Original-Präsentation in Form eines
Diavortrags weit stärker betont, weil die
entsprechenden Zeilen zu den einzelnen Bildern eindringlich
vorgelesen und jeweils mit brüskem Gong markiert
werden. Man könnte eine solche dritte Funktionsstufe
wohl Verstehen durch Übersetzen nennen. Der
Pflaumenbaum Am weitesten aber gehen wohl Bilder, die die gedankliche Abstraktion der Gedichte in szenische Wahrheit über- und gleichzeitig weit über den Text hinausführen, wie eben nur Bilder solchen sprachlichen Gebilden oder Prophetien Raum geben können, so im nebenstrehenden Gedicht "Arche Noah I" von Claudia Storz: "Aussteigen. Ein leeres Land - ein neuer Pfad" (she. hochformatiges Schlussbild). Es fällt nicht leicht, diese Funk-tion autonomenNachschaffens noch von unabhängigem Neuschaffen zu trennen; dennoch ist sie das Resultat produktiver Auseinandersetzung, zumal die Schülerin ihre Bilder mit Hilfe eines analytischen Plans konzipiert hatte:
Schwieriger wird diese Frage nach den kognitiven Leistungen bildnerisch-tonlicher Gestaltung aber bei szenischen Lösungen und bei Videokreationen. Ausdrücklich verlangt wird ein bestimmtes Medium in all den acht Semester-projekten nur ein einziges Mal, und zwar für den Video-Lehrfilm zum Thema "Eigenständiges Lernen"(4. Semester). Mit dem Beschrieb eines einzigen Beispiels einer Video-Installation muss ich es hier bewenden lassen. Das Gedicht "Alle Tage" von Ingeborg Bachmann wurde als szenisches Arrangement (Präsentation zur Phase II des Lyrikprogramms) erarbeitet, indem Bilder mit erläuternder Funktion(Laufbildzitate aus Hitlerfilmen geben die historisch Situierung) per Overhead links auf den schwarzen Vorhang projiziert werden, während ein Beamer eigene Laufbilder als auslegende Einblendungen(zu Beginn Laufbild-Kämpfe aus Computer-Spielen und gegen Ende heitere Kinder-Spielszenen auf Langholzschaukel) in die Mitte der Bühnenwand wirft; rechts aussen rezitiert ein Sprecher zu zu gebet-hafter Musik den Originaltext nüchtern, aber sehr langsam bei Kerzenlicht. Ich erwähne dies so ausführlich, weil solche Bildlogik alle Züge von kognitiver Kreativität aufweist. Diese szenische Präsentation wurde schliesslich (Phase III) als Endprodukt mit analoger Logik videographiert, wobei der Text zur selben gebetartigen Musik schreibmaschinenhaft eingetippt und immer wieder mit der Kerzenflamme überblendet wird; der Videoclip mündet in das herangezoomte Bild der Hoffnungs-Kerze auf der Spitze eines Aus-sichtsturms in eniem Aarauer Kinderspielplatz. Zwar ist gerade bei Video-Produktionen die Tendenz Richtung illustrativ-platter Abbildung von Textinhalten, in auffälligem Unterschied zu bildnerischen Umsetzungen, eher häufig; vielleicht hängt dies mit der bisher eher rudimentären medienpädagogischen Ausrichtung der Schule zusammen. Aber merkwürdig undiffe-renziert sind bisher fast alle tonlichen Produktionen ausgefallen, obwohl es seit langem schulmusikalische Erziehung gibt. Der Unterschied zwischen bildnerischer und musikalischer Usanz basiert vielleicht auf gesamtkulturellen Differenzen: zeichnen und malen glaubt jedermann zu können, Musik aber wird in sündhaft teuren Videoclips und mit perfektesten HiFi/Stereoanlagen reproduziert. Die reichste Vielfalt von Präsentations-Formen und didaktischen Einfällen ist hingegen im szenischen Bereich (Darstellendes Spiel) zu finden. Da reicht die Palette von Mitspiel-Theater (z.B. zur Vergegenwärtigung der Osterspielentwicklung von Ostersequenz über Osterfeier zum breitangelegten Osterspiel), über inszenierte Museumsführungen (für Max Frischs "Stiller"), Postenläufe (mit Rollenspielen zum Thema Körpersprache) und Brettspiele (Ratgeben und sich beraten lassen) bis zum dokumentarischen Theater (Nestroy kommentiert aus dem Jenseits die Schüler-Aufführung der "früheren Verhältnisse"). Und völlig selbst-verständlich werden auch Beiträge für das Internet oder CD-Brenner konzipiert und entwickelt. Die bisherigen
Ausführungen belegen eine, wenn überhaupt, allzu
simple Untersuchungsform: registriert, beschrieben und ein
bisscxhen geordnet wurden unsystematisch ausgewählte
Semesterprojekte verschiedener Klassen ohne jeden Versuch zu
Quantifizierung. Bestenfalls habe ich aber dennoch sichtbar
machen können, dass sich eine zuverlässigere
Auswertung dieses zentralen Interessenbereichs intermedialer
Didaktik durch einen praxisorentierte Forschung durch eine
Pädagogische Hochschule lohnen könnte. |
|||||||||||||||||||||
|
|