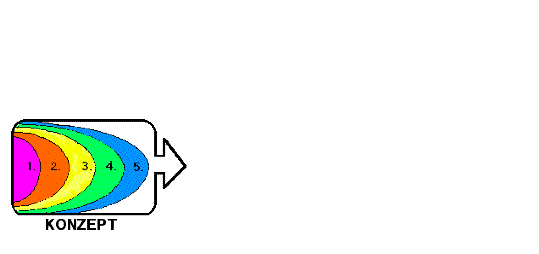|
|

|
(..........konzept.............
|
|
|
|
Das
Lernarrangement des Medienintegrierten
Deutschunterrichts basiert auf drei grundlegenden
Pfeilern, deren weniger vertrautes Prinzip - nebst
"Lernen im Team"und "Präsentation der
zentralen Lernschritte" (also dem Lernen mit Bild,
Ton und Text) - die metakognitive Förderung,
hier gleich mit den wichtigsten konkreten
Instrumenten vorgestellt werden soll. Im Vordergund
stehen - nicht zu Unrecht - zwei zentrale
metakognitive Elemente: das LERNTAGEBUCH und das
KONZEPT. Während das Lerntagebuch als
"Logbuch" (Bordbuch,
in das der Kapitän alle für die
Zielerreichung seines Schiffs essentiellen Daten
einträgt)
primär auf das aktuelle Geschehen fokussiert,
befasst sich das KONZEPT prospektiv, also planend,
mit dem kommenden Projekt, dessen Zielen,
Bedingungen und Phasen. In pädagogischem
Umfeld hat ein Projekt aber drei eigentlich
weitgehend ebenbürtige Elemente:
K O N Z
E P T...........P
R O J E K T (Realisierung).............K
R I T I K
|
Projektlernen hat nicht
die Pädagogik erfunden. Aber im Unterschied zu den in
der Wirtschaft entwickelten "heissen
Projekten",
die höchste Produktivität mittels hoher
Teameffitienz anstreben, will ein pädagogisches Projekt
auch ein hohes Mass an Selbstkompetenz erreichen:
"individuelle Förderung im Dienste von Sacherhellung
durch metakognitive Förderung im Team", oder weniger
pathetisch formuliert: im Mittelpunkt des Modells
Medienintegrierter Deutschunterricht steht die lernende
Persönlichkeit. Dazu dient ein in Anlehnung an das
Kernfach (PSU) des Pädagogisch-Sozialen Gymnasiums
entwickeltes (siehe
"history")
fünfgliedriges KONZEPT:
|
|
|
|
1.
Klärung von Motiv+ Interesse
2.
Vom
Lernziel zur Leitfrage
3.
Von
Leitfragen zum Gruppen-Thema
4.
Informieren-Planen-Entscheiden
5.
Kontrollinstrumente
|
Es
könnte sich lohnen, sich diese fünf
Schritte, für die sich erfolgreiche Lernende
überaus viel Zeit nehmen, sehr genau
anzusehen:
Details
zum "Konzept"
|
Anmerkungen
zum "PROJEKT" in der
Pädagogik:
Ein schulisch
nutzbares, durchdachtes "Projekt"
geht nach Karl Frey, ETH Zürich, von einer
- PROJEKTIDEE
aus, weitet sich zur
- PROJEKTSKIZZE,
wird konkretisiert zum
- PROJEKTPLAN
mit entsprechend bedachten
- PROJEKTZIELEN,
und führt über die konsequente
- PROJEKTREALISIERUNG
zu einem greifbaren
- PRODUKT,
das in „Lebensnähe" mit
„gesellschaftlicher Relevanz" münden
soll.
Zentral an
eigentlichen „PROJEKTEN" ist die über Mitsprache
hinausgehende MITBESTIMMUNG der beteiligten Lernenden
- und die Reduktion der Lehrerrolle auf BERATUNG und
BEGLEITUNG. Spannend wird es wohl, wenn man mit
dieser Konzeption die "heissen
Projekte" der
Lehrlingsausbildung vergleicht.
Bemerkung
zur Phase "KRITIK":
Für die nachhaltige Entwicklung eigenständig
Lernender ist beim Projektlernen diese Phase wohl die
schwierigste. Man kann sie sich natürlich auch leicht
machen, indem man sich auf Kritik in der Sachebene
beschränkt. Pädagogische Lernkonzepte betonen im
"Projekt" aber gerade die Kritik bezügölich dieser
Mitbestimmung der Lernenden: Habe ich nicht nur das
erwartbare Produkt realisiert, sondern vor allem auch meine
Lernziele erreicht. und meine Leitfrage beantwortet? Die
genaue Abstimmung von Lernen und Auftrag auf die
persönliche Motivation der Einzelnen und der Teams
führt dazu, dass diese Phase mehr Zeit braucht . Sie
kann - wenn die Realisierung des Projektprodukts nicht hat
plangemäss durchgeführt werden können - sogar
die m isslungene Realisierung kompensieren und somit
wichtiger sein als diese. In jedem Fall braucht die
Verwirklichung der Gundidee dieser Projekt-"Kritik" sehr
viel kreative organisatorische Phantasie, damit sich diese
Reflexionen, insbesondere wenn eine Reihe von Projekten
angesetzt ist wie im Medienintegrierten Deutschunterricht,
sich nicht "wiederholen" und abnutzen.
|